GCI unterstützt den HYDMOD 2025 Workshop
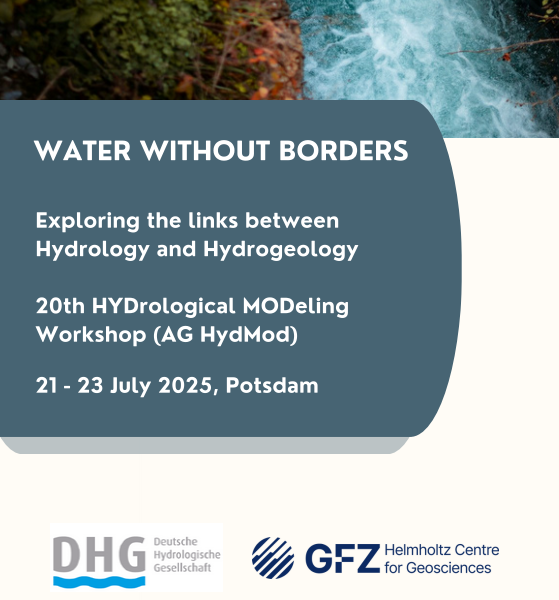
Wir freuen uns, den 20. HYDrological MODeling Workshop (AG HydMod) mit einer Spende zu unterstützen! Die Veranstaltung findet vom 21. bis 23. Juli 2025 am GFZ Helmholtz-Zentrum in Potsdam statt.
Unter dem Motto "Water Without Borders – Exploring the Links Between Hydrology and Hydrogeology" bringt der Workshop NachwuchswissenschaftlerInnen zusammen, um aktuelle Herausforderungen wie Klimawandel, Extremereignisse und grenzüberschreitende Umweltverschmutzung zu diskutieren. Neben wissenschaftlichen Vorträgen und Workshops stehen Networking und Karriereförderung im Mittelpunkt.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: hydmod25.github.io
oder im Flyer: HydMod2025
Vortrag auf der DVGW-Fachkonferenz zu Resilienzstrategien in der Wasserversorgung

Am 18. und 19. März 2025 fand die Online-Fachkonferenz "Resilienzstrategien und Risikomanagement in der Wasserversorgung" des DVGW statt. GCI war mit einem Thema aus der Praxis vertreten und zeigte die Auswirkungen des Klimawandels auf Einzugsgebietsebene für ein Wasserwerk in Sachsen-Anhalt auf Basis einer modellgestützten Bearbeitung. Damit leistete GCI einen Beitrag zur Diskussion über aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze in der Wasserversorgung.
Weiterhin thematisierte die Konferenz unter anderem:
Vortrag beim 26. Symposium "Strategien zur Sanierung von Boden und Grundwasser"

Am 25. November 2024 hielt Herr Hein einen Vortrag zum Thema "GCI-Rohrpassivsammler – Eine Innovation zur Überwachung von PFAS und anderen Wasserinhaltsstoffen" auf dem 26. Symposium „Strategien zur Sanierung von Boden und Grundwasser“ in Frankfurt am Main. Die Veranstaltung, die sich mit aktuellen Fragestellungen und Herausforderungen der Boden- und Grundwassersanierung beschäftigte, war ein wichtiger Treffpunkt für Fachleute aus Forschung, Praxis und Industrie.
Herr Hein stellte in seinem Vortrag den innovativen GCI-Rohrpassivsammler vor, ein neues Verfahren zur Überwachung von PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) sowie anderen Wasserinhaltsstoffen. Der Vortrag stieß auf großes Interesse beim Publikum, das die Innovation als wertvollen Beitrag zur Überwachung und Sanierung von Boden und Grundwasser sieht. Wir danken allen Teilnehmern für den regen Austausch und die spannenden Diskussionen.
Für alle, die mehr über die GCI-Rohrpassivsammler erfahren möchten, stellen wir nun die Vortragsfolien als PDF-Datei zum Download bereit. Diese können Sie über den folgenden Link herunterladen:
Das 26. Symposium bot zudem zahlreiche Einblicke in die neuesten Forschungsergebnisse und Technologien zur Sanierung von Boden und Grundwasser und beleuchtete unter anderem die Herausforderungen im Umgang mit persistenten und toxischen Stoffen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch praxisorientierte Lösungen und innovative Ansätze für eine effiziente Sanierung diskutiert.
Publikation zur Kalibrierung des GCI-Rohrpassivsammlers für Mikroschadstoffe

Wir freuen uns, die Veröffentlichung einer neuen Studie bekannt zu geben, an der unser Mitarbeiter, Herr Jörg-Helge Hein, beteiligt war. Die Studie, die am 19. November 2024 in der Fachzeitschrift ACS ES&T Water veröffentlicht wurde, behandelt die in-situ-Kalibrierung des GCI-Rohrpassivsammlers (tube passive sampling device - TPS) für die Bewertung von Mikroschadstoffen in Abwasser.
Die Autoren – Tobias Hensel, Jörg-Helge Hein, Thorsten Reemtsma, Alexander Sperlich, Regina Gnirß und Frederik Zietzschmann – präsentieren in der Studie den GCI-Rohrpassivsammler als ein innovatives Gerät mit einstellbarem volumetrischem Durchfluss, das in der Lage ist, die Aufnahme von organischen Mikroschadstoffen (OMPs) in Abwasser mit stark schwankenden Konzentrationen präzise zu messen. Diese halb-passive Methode ermöglicht eine genaue Bestimmung der Wassermenge, die den Sammler speist, und gewährleistet stabile, kontrollierte Probenahmebedingungen, auch an geschlossenen Rohrleitungen.
Durch die Kalibrierung des GCI-Rohrpassivsammlers gegen die Last der organischen Mikroschadstoffe im Zufluss konnte die Studie eine hohe Übereinstimmung zwischen den berechneten Konzentrationen aus den Messungen und den begleitend während der Kalibrierung direkt im Wasser gemessenen Konzentrationen erreichen. Dies zeigt das Potenzial des GCI-Rohrpassivsammlers, bestehende Online-Messmethoden in Abwasserbehandlungsanlagen zu unterstützen und integrierte Wasseranalysen für die Überwachung der Abwassereinleitungen zu liefern.
Die Ergebnisse dieser Studie sind ein weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung der Überwachung von Mikroschadstoffen in Abwässern und bieten vielversprechende Perspektiven für die Umweltforschung und den Schutz der Gewässer.
Mehr über die Studie erfahren Sie in der vollständigen Veröffentlichung: DOI-Link zur Studie.
Weitere Informationen zum GCI-Rohrpassivsammler finden Sie hier auf unserer Homepage.
Informationsveranstaltung von LfU Brandenburg und GCI GmbH zum Projekt „Rohwasserbeschaffenheit“

Am 21.11.2024 richtete das LfU Brandenburg eine Informationsveranstaltung für die Wasserversorgungsunternehmen zum Projekt
„Erfassung belastungsrelevanter Parameter in Rohwasserproben von Wasserwerken im Land Brandenburg“ aus, das GCI GmbH bearbeitet hat. Antje Oelze (LfU, Leiterin des Referats W15 „Altlasten, Bodenschutz, Grundwassergüte“), Stefan Pohl (LfU, W15) und Florian Jenn (GCI) stellten das Projekt und die Ergebnisse vor und diskutierten anschließend mit den Teilnehmern.
Das Projekt läuft seit 2003. In den mittlerweile 12 Teilprojekten wurden jeweils für Zeiträume von 2 – 3 Jahren Analysen und weitere Daten zu Brunnen, Rohmischwasser und Grundwassermessstellen bei den Wasserversorgungsunternehmen im Land Brandenburg erhoben und statistisch ausgewertet.
Die Ergebnisse der Teilprojekte 7 bis 11 (Erfassungszeitraum 2010 – 2019) wurden von LfU und GCI GmbH in der Broschüre „Rohwasserbeschaffenheit Land Brandenburg 2010 – 2019“ (LfU 2024) zusammengefasst. Die Ergebnisse des neuesten Teilprojekts 12 (Erfassungszeitraum 2020 – 2022) wurden auf der Informationsveranstaltung am 21.11.2024 vorgestellt.
Herr Jenn beschrieb die Vorgehensweise bei der Erhebung und Plausibilitätsprüfung der Daten, um die damit vorhandene Datengrundlage zu charakterisieren. Die primärstatistische Auswertung dieser Datengrundlage mittels statistischer Kennwerte, Histogrammen und Boxplots auf Landesebene stellte den nächsten Themenblock des Vortrags dar. Aus diesen Ergebnissen entwickelte sich eine lebhafte Diskussion zu den Parametern Nitrat, Sulfat und allgemein zur landwirtschaftlichen Beeinflussung des Grundwassers. Diese wurde weiter vertieft in der Präsentation zu den Ergebnissen der Trendanalyse für die Leitparameter der Grund- und Rohwasserbeschaffenheit. Darauf folgte der größte Themenblock, die Bewertung der Beeinflussung des Grund- und Rohwassers der Wasserwerke anhand ausgewählter Leitparameter.
Voraussichtlich bis Jahresende werden GCI und LfU relevante wasserwerksbezogene Ergebnisse des Teilprojekts 12 für die Wasserversorgungsunternehmen bereitstellen.
